Hopfen beim Bierbrauen: Apolon
Veröffentlicht: 30. Oktober 2025 um 08:48:28 UTC
Die Apolon-Hopfen nehmen unter den slowenischen Hopfensorten eine Sonderstellung ein. Sie wurden in den 1970er Jahren von Dr. Tone Wagner am Hopfenforschungsinstitut in Žalec entwickelt und stammen von der Sämling Nr. 18/57 ab. Diese Sorte vereint Brewer's Gold mit einer jugoslawischen Wildhopfen-Männchen-Variante und zeichnet sich durch robuste agronomische Eigenschaften sowie ein charakteristisches Harz- und Ölprofil aus. Diese Eigenschaften sind für Brauer von unschätzbarem Wert.
Hops in Beer Brewing: Apolon

Als vielseitig einsetzbarer Hopfen eignet sich Apolon hervorragend sowohl für Bitterkeit als auch für Aroma. Er weist einen Alpha-Säuregehalt von 10–12 %, einen Beta-Säuregehalt von etwa 4 % und einen Gesamtölgehalt von 1,3–1,6 ml pro 100 g auf. Myrcen ist mit 62–64 % der dominierende Ölbestandteil. Dieses Profil macht Apolon attraktiv für Brauer, die den Myrcengehalt erhöhen möchten, ohne die Bitterkeit zu beeinträchtigen.
Trotz rückläufiger Anbauzahlen ist Apolon nach wie vor wirtschaftlich rentabel. Für amerikanische Craft-Brauer, die ihre Hopfenauswahl erweitern möchten, ist er eine ausgezeichnete Wahl. Dieser Artikel beleuchtet Agronomie, Chemie, Geschmack und praktische Anwendungsmöglichkeiten von Apolon beim Brauen.
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Apolon-Hopfensorte ist eine slowenische Selektion aus den 1970er Jahren, gezüchtet in Žalec.
- Die Hopfensorte Apolon ist eine Zweinutzungssorte mit einem Gehalt von ca. 10–12 % Alpha-Säuren und einem Myrcen-reichen Ölprofil.
- Seine chemische Zusammensetzung unterstützt sowohl die Bitterkeit als auch die Aromatisierung in Bierrezepten.
- Der kommerzielle Anbau ist zurückgegangen, aber Apolon ist für handwerkliche Brauer weiterhin nützlich.
- Dieser Artikel befasst sich mit Agronomie, Geschmack, Brautechniken und Rohstoffbeschaffung.
Überblick über Apolon-Hopfen
Apolon, eine slowenische Hybrid-Hopfensorte, stammt aus der Super-Steirischen Linie. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Brauprozesses und wird zum Bitterhopfen und für späte Hopfengaben verwendet. Dadurch entwickelt das Bier blumige und harzige Noten.
Die Apolon-Hopfenanalyse zeigt einen moderaten Gehalt an Alpha-Säuren von typischerweise 10–12 %, im Durchschnitt etwa 11 %. Der Gehalt an Beta-Säuren liegt bei etwa 4 %, der Gehalt an Co-Humulon ist mit rund 2,3 % niedrig. Der Gesamtgehalt an Ölen beträgt 1,3 bis 1,6 ml pro 100 g und ist damit ideal für die Aromatisierung von Ales.
Als vielseitiger slowenischer Hopfen wurde Apolon ursprünglich für die Bitterkeit gezüchtet, eignet sich aber auch hervorragend zur Aromatisierung. Er ist ideal für ESB, IPA und verschiedene Ales. Er bietet eine klare Bitterkeit und ein subtiles blumig-harziges Aroma.
- Produktion und Verfügbarkeit: Der Anbau ist zurückgegangen und die Beschaffung kann für Großabnehmer schwierig sein.
- Primäre Messgrößen: Alpha-Säuren ~11%, Beta-Säuren ~4%, Co-Humulon ~2,3%, Gesamtöle 1,3–1,6 ml/100 g.
- Typische Anwendungen: Bitterbasis mit Verwendungsmöglichkeiten für späte Zugaben und Kalthopfung.
Trotz reduzierter Anbaufläche bleibt Apolon für Craft- und Regionalbrauer eine attraktive Option. Es handelt sich um eine vielseitige Hopfensorte. Die Kurzbeschreibung von Apolon hilft dabei, Bitterkeit und Aroma in Bierrezepten auszubalancieren.
Botanische und agronomische Merkmale
Apolon wurde Anfang der 1970er Jahre von Dr. Tone Wagner am Hopfenforschungsinstitut in Žalec, Slowenien, entwickelt. Die Sorte stammt von der Sämlingsauswahl Nr. 18/57, einer Kreuzung zwischen Brewer’s Gold und einem jugoslawischen Wildhopfen. Damit ist Apolon zwar Teil des slowenischen Hopfenanbaus, aber gleichzeitig auch eine gezielte Hybridzüchtung.
Klassifizierungsunterlagen belegen, dass Apolon von der Gruppe „Super Steirisch“ in eine anerkannte slowenische Hybride umklassifiziert wurde. Diese Änderung unterstreicht seine regionale Züchtungsgeschichte und seine Eignung für lokale Anbausysteme. Landwirte sollten bei der Planung des Anbaus von Apolon die späte Reifezeit berücksichtigen.
Feldberichte beschreiben das Hopfenwachstum als kräftig, mit hohen bis sehr hohen Wachstumsraten. Die Erträge variieren je nach Standort, liegen aber im Durchschnitt bei etwa 1000 kg pro Hektar bzw. rund 890 Pfund pro Acre. Diese Werte bieten eine realistische Grundlage für die Schätzung des kommerziellen Ertrags in vergleichbaren Klimazonen.
Hinsichtlich der Krankheitsresistenz zeigt Apolon eine moderate Toleranz gegenüber Falschem Mehltau. Diese hohe Widerstandsfähigkeit kann die Spritzhäufigkeit in feuchten Jahreszeiten reduzieren, dennoch bleibt ein integrierter Pflanzenschutz wichtig. Beobachtungen aus dem slowenischen Hopfenanbau unterstreichen die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrollen zur Erhaltung der Pflanzengesundheit.
Die Eigenschaften der Dolden, wie Größe und Dichte, werden uneinheitlich berichtet, was auf die reduzierte Anbaufläche und die begrenzte Anzahl aktueller Versuche zurückzuführen ist. Das Lagerverhalten zeigt uneinheitliche Ergebnisse: Eine Quelle gibt an, dass Apolon nach sechs Monaten bei 20 °C (68 °F) etwa 57 % der Alpha-Säuren behält. Eine andere Quelle nennt einen Hopfenlagerindex von etwa 0,43, was auf eine relativ geringe Langzeitstabilität hindeutet.
Für Anbauer, die die Agronomie von Apolon in Betracht ziehen, ergibt sich durch die Kombination aus starkem Hopfenwachstum, moderatem Ertrag und mäßiger Krankheitsresistenz ein klares agronomisches Profil. Praktische Entscheidungen bezüglich Erntezeitpunkt und Nacherntebehandlung beeinflussen den Alpha-Säure-Gehalt und die Marktfähigkeit.
Chemisches Profil und Brauwerte
Der Alpha-Säuregehalt von Apolon liegt zwischen 10 und 12 %, im Durchschnitt bei etwa 11 %. Dadurch ist Apolon eine beliebte Wahl für Bitterhopfen. Er bietet eine zuverlässige Bitterkeit, ohne die IBU-Werte zu erhöhen.
Der Beta-Säure-Gehalt von Apolon liegt bei etwa 4 %. Beta-Säuren tragen zwar nicht zur Bitterkeit in heißer Würze bei, beeinflussen aber das Harzprofil des Hopfens. Dies wirkt sich auf Reifung und Stabilität aus.
Der Co-Humulon-Gehalt von Apolon ist mit etwa 2,25 % (durchschnittlich 2,3 %) bemerkenswert niedrig. Dieser niedrige Co-Humulon-Gehalt deutet auf eine mildere Bitterkeit im Vergleich zu vielen anderen Sorten hin.
- Gesamtölgehalt: 1,3–1,6 ml pro 100 g (durchschnittlich ~1,5 ml/100 g).
- Myrcen: 62–64 % (durchschnittlich 63 %).
- Humulen: 25–27% (durchschnittlich 26%).
- Caryophyllen: 3–5% (durchschnittlich 4%).
- Farnesen: ~11–12 % (durchschnittlich 11,5 %).
- Zu den Spurenstoffen gehören β-Pinen, Linalool, Geraniol und Selinen.
Die Hopfenölzusammensetzung von Apolon ist dank des hohen Myrcengehalts reich an harzigen, zitrusartigen und fruchtigen Noten. Humulen und Caryophyllen steuern holzige, würzige und kräuterartige Nuancen bei. Farnesen verleiht dem Hopfen grüne und blumige Noten und verstärkt das Aroma beim späten Kochen oder Kalthopfen.
Die HSI-Werte von Apolon reagieren empfindlich auf die Frische. Die HSI-Werte liegen bei etwa 0,43 (43 %), was auf einen signifikanten Verlust an Alpha- und Beta-Säuren nach sechs Monaten bei Raumtemperatur hindeutet. Eine weitere Messung ergab, dass Apolon nach sechs Monaten bei 20 °C noch etwa 57 % der Alpha-Säuren enthielt.
Praktische Hinweise für den Brauprozess: Verwenden Sie Apolon frühzeitig für eine gleichmäßige Bitterung, bei der Alpha-Säuren entscheidend sind. Geben Sie später weitere Bitterstoffe hinzu oder würzen Sie mit Kalthopfen, um die Zusammensetzung des Hopfenöls hervorzuheben und flüchtige Aromastoffe zu erhalten. Lagern Sie das Bier kühl und verschlossen, um den durch den Hopfen-Säure-Effekt bedingten Qualitätsverlust zu minimieren und Harz- und Aromacharakter zu bewahren.
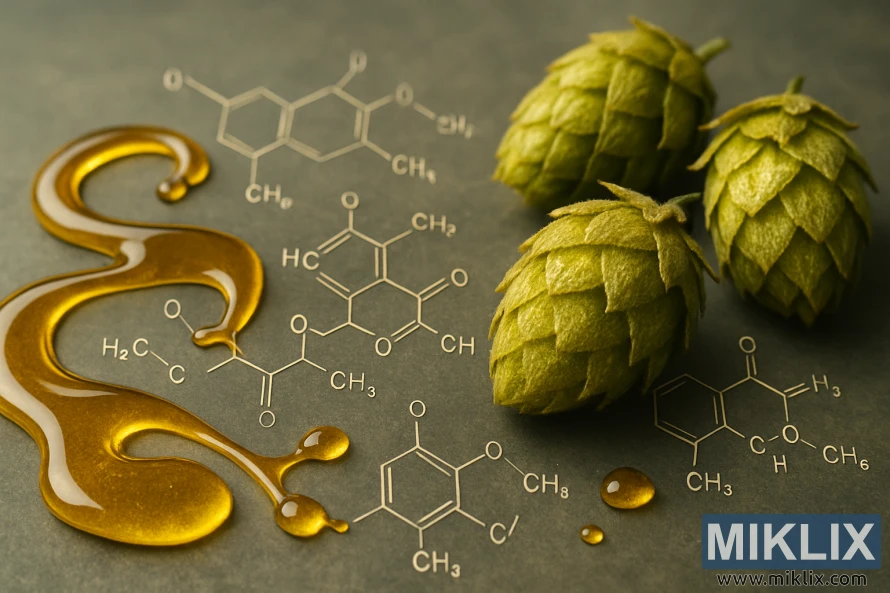
Apollon hüpft
Die Apolon-Hopfensorten haben ihren Ursprung in mitteleuropäischen Zuchtprogrammen. Ursprünglich in den 1970er-Jahren als Super Styrian bekannt, wurden sie später als slowenische Hybride neu klassifiziert. Diese Namensänderung erklärt die Diskrepanzen in älteren Katalogen, in denen dieselbe Sorte unter verschiedenen Namen aufgeführt ist.
Züchter haben Apolon zusammen mit seinen Geschwistern Ahil und Atlas in eine Gruppe eingeordnet. Diese Hopfensorten teilen eine gemeinsame Abstammung und weisen Ähnlichkeiten in Bitterkeit und Aroma auf. Für Brauer, die sich für die Herkunft des Hopfens interessieren, kann das Wissen um diese genetischen Verbindungen ihr Verständnis des Hopfencharakters vertiefen.
Die kommerzielle Verfügbarkeit von Apolon-Hopfen ist eingeschränkt. Im Gegensatz zu Cascade oder Hallertau, die in großem Umfang angebaut werden, ist Apolon weniger verbreitet. Er ist je nach Erntejahr und Verfügbarkeit bei Kleinbauern und spezialisierten Anbietern als ganze Dolde oder in Pelletform erhältlich.
Die Verfügbarkeit kann je nach Saison und Anbieter schwanken. Online-Marktplätze bieten Apolon gelegentlich in kleinen Mengen an. Preis und Frische hängen direkt vom Erntejahr ab. Käufer sollten daher unbedingt vor dem Kauf das Erntejahr und die Lagerbedingungen überprüfen.
Apolon wird derzeit in den traditionellen Darreichungsformen angeboten: als ganze Zapfen und als Pellets. Lupulinpulver oder konzentrierte Kryoprodukte sind für diese Sorte momentan nicht erhältlich.
- Typische Formate: ganze Kegel, Pellets
- Verwandte Sorten: Ahil, Atlas
- Historisches Etikett: Super Steirischer Hopfen
Bei der Entwicklung von Rezepten für kleine Braumengen ist es unerlässlich, Informationen über Apolon-Hopfen zu berücksichtigen. So bleiben Sie über Verfügbarkeit und Laboranalysen informiert. Das Verständnis der Eigenschaften von Apolon-Hopfen hilft dabei, ihn dem jeweiligen Brauprofil zuzuordnen oder bei Lieferengpässen geeignete Alternativen zu finden.
Geschmacks- und Aromaprofil
Der Geschmack von Apolon zeichnet sich durch eine von Myrcen geprägte Signatur aus, wenn die Dolden frisch sind. Der erste Eindruck ist harzig mit hellen Zitrusnoten, die sich zu Steinobst und leichten tropischen Anklängen entwickeln. Dadurch eignet sich Apolon ideal für späte Hopfengaben im Braukessel und zum Kalthopfen, wo die flüchtigen Öle besonders gut zur Geltung kommen.
Das Aroma von Apolon besticht durch eine perfekte Balance aus Harz und Holznoten. Humulen verleiht ihm eine trockene, edel-würzige Basis. Caryophyllen steuert subtile Pfeffer- und Kräuternuancen bei und rundet das Profil ab. Die Kombination der Öle betont sowohl harzige Kiefernoten als auch spritzige Zitrusaromen, die oft als Kiefer-Zitrus-Harz-Hopfen beschrieben werden.
Im fertigen Bier erwartet Sie ein vielschichtiges Geschmackserlebnis. Der spritzige Zitrusgeschmack dominiert, gefolgt von einer harzigen Note im Mittelteil und einem holzig-würzigen Abgang. Der Farnesenanteil verleiht dem Bier grüne und blumige Nuancen und unterscheidet Apolon von anderen Sorten mit hohem Alpha-Säuregehalt. Der niedrige Cohumulon-Gehalt sorgt für eine angenehme, nicht herbe Bitterkeit.
- Geriebene Zapfen: starker Myrcen-Hopfencharakter, Zitrus- und Harznoten.
- Spätere Zugaben im Kessel: Aromaaufbau ohne übermäßige Bitterkeit.
- Kalthopfung: Verstärkt die harzigen, kiefernartigen Zitrusnoten und die flüchtigen Öle des Hopfens.
Im Vergleich zu anderen Bitterhefesorten weist Apolon eine ähnliche Alpha-Säurestärke auf, zeichnet sich aber durch ein ausgewogenes Ölverhältnis aus. Das Vorhandensein von Farnesen und die Mischung aus Myrcen, Humulen und Caryophyllen erzeugen ein komplexes, vielschichtiges Aroma. Brauer, die sowohl zuverlässige Bitterkeit als auch aromatische Tiefe suchen, werden feststellen, dass Apolon vielseitig in vielen Bierstilen einsetzbar ist.
Brautechniken mit Apolon
Apolon ist ein vielseitiger Hopfen, der sich sowohl für die frühe Bitterung während des Kochens als auch für die späte Aromazugabe eignet. Seine 10–12 % Alpha-Säuren tragen dank des niedrigen Cohumulon-Gehalts zu einer milden Bitterkeit bei. Die myrcenreichen Öle verleihen dem Bier, wenn sie erhalten bleiben, einen harzigen, zitrusartigen und holzigen Charakter.
Für die Bitterung wird Apolon wie andere Hopfensorten mit hohem Alpha-Säuregehalt behandelt. Berechnen Sie die benötigte Menge, um den gewünschten IBU-Wert zu erreichen, und berücksichtigen Sie dabei den Lagerindex und die Frische des Hopfens. Bei einem Kochvorgang von 60 Minuten ist mit einer Standardausnutzung zu rechnen, planen Sie Ihre Apolon-Zugaben daher sorgfältig.
Die Zugabe von Apolon gegen Ende des Kochvorgangs und im Whirlpool eignet sich ideal, um die ätherischen Öle zu erhalten. Geben Sie Apolon nach dem Abkühlen oder während eines 15- bis 30-minütigen Whirlpool-Prozesses bei 77–82 °C hinzu, um Myrcen und Humulen zu bewahren. Eine geringe Menge im Whirlpool kann das Aroma verstärken, ohne unangenehme, grasige Noten einzubringen.
Durch Kalthopfen werden die harzigen und zitrusartigen Aromen von Apolon hervorgehoben. Verwenden Sie es in Mengen von 3–7 g/l, um Ales ein deutlich wahrnehmbares Aroma zu verleihen. Verfügbarkeit und Preis von Apolon können Ihre Strategie beim Kalthopfen beeinflussen; berücksichtigen Sie diese Faktoren daher bei der Planung Ihrer Zugaben.
- Primäre Bitterung: Standard-IBU-Berechnung mit 10–12 % Alpha-Säuren.
- Spät/Whirlpool: Bei Flammenausklang oder in einem kühlen Whirlpool hinzufügen, um das Aroma zu erhalten.
- Kalthopfung: Mäßige Mengen für harzig-zitrusartige Aromen; passende Mischungspartner in Betracht ziehen.
Für Apolon gibt es keine kommerziellen Kryo- oder Lupulin-Formate. Verwenden Sie ganze Dolden oder Pellets und passen Sie die Dosierung dem Pasteurisierungsgrad bzw. der Frische des Materials an. Beim Mischen empfiehlt es sich, Apolon mit reinen Basishopfen wie Citra, Sorachi Ace oder traditionellen Edelhopfen zu kombinieren, um Bitterkeit und Aroma auszubalancieren.
Die Dosierung von Apolon-Hopfen hängt vom Bierstil und der Malzmischung ab. Bei IPAs sollte die späte Hopfengabe und die Kalthopfung erhöht werden. Bei Lager- oder Pilsnern hingegen wird die frühe Bitterung stärker und die späte schwächer dosiert, um ein reineres Hopfenprofil zu erzielen. Die Ergebnisse sollten regelmäßig überprüft und die Dosierung sowie der Zeitpunkt der Hopfengabe (in Gramm pro Liter) für jeden Sud angepasst werden, um gleichbleibende Resultate zu gewährleisten.

Die besten Bierstile für Apolon
Apolon eignet sich hervorragend für Biere, die eine kräftige Bitterkeit und eine zitrusartige Note benötigen. Es ist perfekt für IPAs, da es eine solide Bitterkeit beisteuert und gleichzeitig Kiefern- und Zitrusnoten hinzufügt. Das Kalthopfen mit Apolon in Double IPAs verstärkt das Aroma, ohne die Hopfenmischung zu überdecken.
In traditionellen britischen Ales sorgt Apolon ESB für eine ausgewogene Bitterkeit. Es verleiht ihnen eine subtile Zitrusnote und eine abgerundete Bitterkeit und passt hervorragend zu Session-Bieren und stärkeren ESBs.
Starke Ales, Barley Wines und Stouts im amerikanischen Stil profitieren von der Struktur von Apolon. In dunklen, malzbetonten Bieren sorgt Apolon für eine kräftige Bitterkeit und holzige, harzige Aromen. Diese harmonieren hervorragend mit Karamell- und Röstaromen.
- India Pale Ales: Verwenden Sie Apolon für IPAs früh für die Bitterung, spät für das Aroma. Kombinieren Sie es mit Citra oder Simcoe für vielschichtige Zitrus- und Kiefernoten.
- Extra Special Bitter: Apolon ESB erzeugt eine klassische Bitterkeit mit einem reineren, fruchtigeren Abgang.
- Starke Ales und Barley Wines: Mit Apolon lässt sich die Malzsüße ausgleichen und eine harzige Note hinzufügen.
- Amerikanische Stouts: Verwenden Sie mäßige Mengen für die Bitterkeit und einen Hauch von holzigem Harz, ohne den Röstgeschmack zu sehr zu verstärken.
Viele Brauereien wählen Hopfensorten mit hohem Alpha-Säuregehalt und Zitrus-Kiefern-Aroma, um ähnliche Effekte zu erzielen. Biere mit Apolon sind kräftig und hopfenbetont, bleiben aber in verschiedenen Alkoholstärken gut trinkbar.
Ersatzstoffe und Mischungspartner
Bei der Suche nach Apolon-Alternativen sollten Sie sich auf datenbasierte Ähnlichkeiten statt auf Vermutungen stützen. Nutzen Sie Hopfenvergleichstools, die Alpha-Säuren, Ölzusammensetzung und sensorische Merkmale vergleichen. Diese Methode hilft, ähnliche Alternativen zu finden.
Suchen Sie nach Hopfen mit einem Alpha-Säuregehalt von etwa 10–12 Prozent und einem Myrcen-betonten Ölprofil. Diese Eigenschaften sorgen für eine ähnliche harzige Note und einen zitrusartigen Körper. Brewer's Gold, als Elternsorte, dient als nützliche Referenz bei der Suche nach Hopfen, der Apolon ersetzen kann.
- Für die Bitterung sollten Sie vielseitig einsetzbare, harzige Hopfensorten mit hohem Alpha-Säuregehalt wählen, die dem Grundcharakter von Apolon entsprechen.
- Zur Aromaanpassung sollten Hopfensorten mit passendem Myrcen- und moderatem Humulengehalt ausgewählt werden, um die Balance zu wahren.
Die Hopfenmischung mit Apolon ist am effektivsten, wenn Apolon als Strukturhopfen eingesetzt wird. Verwenden Sie ihn für die frühe Bitterung und kombinieren Sie ihn mit späteren Zugaben, um die Komplexität zu erhöhen.
Kombinieren Sie ihn mit tropischen oder fruchtigen Sorten, um die Aromenvielfalt zu erhöhen. Citra, Mosaic und Amarillo bieten helle, ausdrucksstarke Kopfnoten, die einen Kontrast zum harzigen Kern bilden. Dieser Kontrast verstärkt die wahrgenommene Tiefe, ohne den Charakter von Apolon zu verdecken.
Für holzige oder würzige Noten wählen Sie Hopfensorten mit einem höheren Humulen- oder Caryophyllengehalt. Diese ergänzen das zitrusartige Harzprofil von Apolon mit herzhaften Nuancen.
- Entscheiden Sie über die Rolle: Hauptbitterkeit oder Aromaakzent.
- Beim Austausch von Ölen müssen die Alpha-Säuren und die Ölstärke aufeinander abgestimmt sein.
- Die späten Zugaben werden sorgfältig eingearbeitet, um das endgültige Aroma zu formen.
Testen Sie stets kleine Chargen, bevor Sie die Produktion skalieren. Verfügbarkeit und Kosten können sich häufig ändern. Flexibilität bei der Wahl einer Hopfensorte, um Apolon zu ersetzen, bewahrt die Rezeptur und gewährleistet gleichzeitig eine praktikable Produktion.
Lagerung, Frische und Lupulinverfügbarkeit
Die Lagerung von Apolon hat einen erheblichen Einfluss auf das Brauergebnis. Ein Apolon-HSI-Wert nahe 0,43 deutet auf eine deutliche Alterung bei Raumtemperatur hin. Laboruntersuchungen zeigen, dass nach sechs Monaten bei 20 °C (68 °F) noch etwa 57 % der Alpha-Säure erhalten bleiben. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Überwachung der Frische von Apolon.
Für eine effektive Lagerung muss Hopfen kühl und sauerstofffrei aufbewahrt werden. Vakuumversiegelte oder mit Stickstoff gespülte Verpackungen verlangsamen den Abbau von Alpha-Säure und flüchtigen Ölen. Kühlung eignet sich für die kurzfristige Verwendung. Gefrieren unter Vakuum oder mit Inertgas bietet die beste Konservierung für eine längere Lagerung.
Die Verfügbarkeit von Lupulin für Apolon ist derzeit eingeschränkt. Die wichtigsten Kryoprodukte von Yakima Chief, LupuLN2 und Hopsteiner sind für diese Sorte nicht erhältlich. Lupulin-Pulver für Apolon ist nicht im Handel verfügbar. Die meisten Anbieter führen Apolon ausschließlich als Ganzes oder als Pellets.
- Beim Kauf sollten Sie Erntejahr und Chargenangaben beachten, um die Frische des Hopfens (Apolon) verschiedener Lieferanten vergleichen zu können.
- Bitte fordern Sie den Speicherverlauf an, wenn die Alpha-Stabilität oder Apolon HSI für Ihr Rezept wichtig sind.
- Kaufen Sie Pellets für eine platzsparende Lagerung; kaufen Sie frische Zapfen für aromaintensive, kurzfristige Projekte.
Für Brauer, die zwischen Langzeitlagerung und sofortiger Verwendung abwägen, bieten gefrorene, inerte Verpackungen verpackte Hopfen eine gleichbleibende Bitterkeit und ein gleichbleibendes Aroma. Die Dokumentation von Kaufdatum und Lagerbedingungen hilft, den Abbauprozess zu verfolgen. Dadurch kann, falls Lupulinpulver (Apolon) später eingeführt wird, die Qualität mit bekannten Referenzwerten verglichen werden.
Sensorische Bewertung und Verkostungsnotizen
Beginnen Sie Ihre sensorische Hopfenprüfung mit dem Riechen ganzer Dolden, Lupulinpulver und Nass-Trocken-Proben. Notieren Sie Ihre ersten Eindrücke und achten Sie anschließend auf Veränderungen nach kurzem Belüften. Diese Methode hebt flüchtige Terpene wie Myrcen, Humulen, Caryophyllen und Farnesen hervor.
Die Verkostung erfolgt in drei Ebenen. Die Kopfnote präsentiert harzige Zitrus- und fruchtige Noten, maßgeblich geprägt von Myrcen. Die Herznote offenbart holzige und würzige Elemente des Humulens, mit pfeffrigen, kräuterartigen Akzenten des Caryophyllens. Die Basisnote zeigt oft frische grüne und zarte florale Anklänge von Farnesen.
Bei der Beurteilung der Bitterkeit sollte man auf den Einfluss von Co-Humulon und Alpha-Säure achten. Die Verkostungsnotizen von Apolon deuten auf ein mildes Bitterprofil hin, das auf den niedrigen Co-Humulon-Gehalt von ca. 2,25 % zurückzuführen ist. Der hohe Gehalt an Alpha-Säure sorgt für eine solide Bitterbasis und ist ideal für die Zugabe zu Beginn des Kochvorgangs.
Bewerten Sie den Aromabeitrag im fertigen Bier, indem Sie späte Hopfengaben und Kalthopfen mit frühen Bitterhopfengaben vergleichen. Spätes Hopfen oder Kalthopfen erzeugt vielschichtige Zitrus-, Harz- und Holzaromen. Frühe Hopfengaben sorgen für eine saubere, stabile Bitterkeit mit geringerer Aromastabilität.
Frische ist entscheidend. Älterer Hopfen verliert flüchtige Aromen, was sich im sensorischen Profil von Apolon abschwächt. Lagern Sie Hopfen kühl und vakuumverpackt, um die lebendigen Zitrus- und Harznoten für eine präzise sensorische Bewertung bei Verkostungen zu erhalten.
- Duft: Zitrus, Harz, fruchtige Kopfnoten.
- Geschmack: holzig-würzig, pfeffrig-kräuterige Mittelnote.
- Abgang: grüne, blumige Anklänge, sanfte Bitterkeit.
Kauf von Apolon-Hopfen
Die Suche nach Apolon-Hopfen beginnt bei seriösen Hopfenhändlern und Brauereiausstattern. Viele Brauer wenden sich an spezialisierte Hopfenhändler, regionale Vertriebspartner oder Online-Marktplätze wie Amazon. Die Verfügbarkeit von Apolon-Hopfen variiert je nach Jahreszeit, Erntejahr und Lagerbestand des Anbieters.
Achten Sie bei der Bestellung auf genaue Chargendaten. Fordern Sie das Erntejahr, Analysen des Alpha-Säure- und Ölgehalts sowie einen gemessenen HSI-Wert oder einen Frischebericht für die Charge an. Diese Informationen sind entscheidend, um die Erwartungen an Bitterkeit und Aroma zu erfüllen.
Überlegen Sie sich vor dem Kauf, welche Darreichungsform Sie benötigen. Ganze Kegel und Pellets erfordern unterschiedliche Lagerungs- und Dosierungsanforderungen. Erkundigen Sie sich bei Ihren Lieferanten nach vakuumversiegelten oder stickstoffgespülten Verpackungen und Kühltransportverfahren.
Beachten Sie, dass einige Anbieter nur über begrenzte Liefermengen verfügen. Der Rückgang des Apolon-Anbaus hat zu Verknappung geführt und wirkt sich auf Preise und Vertrieb aus. Bei größeren Brauvorgängen sollten Sie die Verfügbarkeit und Lieferzeiten mit den Lieferanten abklären, um Verzögerungen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie die Alpha- und Ölanalyse der Charge, die Sie erhalten werden.
- Verpackung prüfen: Vakuumversiegelt oder mit Stickstoff gespült ist am besten.
- Wählen Sie je nach Verarbeitungsprozess und Lagerung entweder ganze Kegel oder Pellets.
- Erkundigen Sie sich nach der Kühlkettenabwicklung bei langen Sendungen.
Lupulinpulver oder kryogene Produkte sind für Apolon derzeit nicht erhältlich. Planen Sie Ihre Rezepte und Hopfengaben mit ganzen oder pelletierten Hopfen. Beim Kauf von Apolon-Hopfen empfiehlt es sich, mehrere Anbieter zu kontaktieren, um Preise, Erntejahre und Lieferbedingungen zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
Historischer Kontext und genetische Abstammung
Die Geschichte der Apolon-Hopfensorte begann in den frühen 1970er Jahren am Hopfenforschungsinstitut in Žalec, Slowenien. Sie entstand als Sämlingsauswahl Nr. 18/57, die speziell für das lokale Klima und die Brauanforderungen entwickelt wurde.
Der Züchtungsprozess umfasste eine strategische Kreuzung zwischen einer englischen Sorte und lokaler Genetik. Ein jugoslawischer Wildrübe wurde mit Brewer's Gold gekreuzt. Diese Kombination verlieh Apolon ein robustes Bitterkeitsprofil und Krankheitsresistenz, ideal für die Bedingungen Mitteleuropas.
Dr. Tone Wagner spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Apolon. Er identifizierte die vielversprechendsten Sämlinge und begleitete die Sorte durch die Versuche. Wagners Bemühungen führten auch zur Entwicklung von Schwestersorten, die in benachbarten Züchtungsprojekten eingesetzt wurden.
In den 1970er Jahren wurde Apolon den Anbauern zunächst als Super-Steirische Sorte vorgestellt. Später wurde sie als slowenische Hybride klassifiziert, was ihre gemischte Abstammung verdeutlichte. Diese Klassifizierungen unterstreichen die damaligen Zuchtziele und regionalen Namensgebungstraditionen.
- Apolon hat genetische Verbindungen zu Sorten wie Ahil und Atlas, die aus ähnlichen Programmen stammen.
- Diese Geschwister weisen überlappende Merkmale in Bezug auf Aroma und Agronomie auf, die für die vergleichende Züchtung nützlich sind.
Trotz seines Potenzials blieb die kommerzielle Verbreitung von Apolon begrenzt. Die Anbaufläche ging im Laufe der Jahre zurück, da andere Sorten an Popularität gewannen. Dennoch sind die Aufzeichnungen über Apolons Ursprung und die Züchtungsnotizen von Dr. Tone Wagner von entscheidender Bedeutung für Hopfenhistoriker und Züchter, die sich für historische Genetik interessieren.

Praktische Heimbrau-Rezepte mit Apolon
Verwenden Sie Apolon als Hauptbitterhopfen in Rezepten, die 10–12 % Alpha-Säure erfordern. Berechnen Sie die Bittereinheiten (IBU) anhand des vor dem Brauen gemessenen Alpha-Säuregehalts Ihrer Charge. So stellen Sie sicher, dass die Rezepte für Apolon IPA und Apolon ESB konsistent und zuverlässig sind.
Für ein Single-Hop-Apolon ESB empfiehlt sich eine Hopfengabe, um die malzigen Untertöne und die subtilen Harznoten hervorzuheben. Bei einem Apolon IPA sollte früh im Kochprozess eine kräftige Bitterhopfengabe erfolgen. Anschließend können späte Whirlpool- oder Kalthopfungen geplant werden, um die Zitrus- und Harzaromen zu verstärken.
- ESB-Verfahren mit nur einer Hopfensorte: Basismalz 85–90 %, Spezialmalze 10–15 %, Bitterung mit Apolon nach 60 Minuten; späte Zugabe von Apolon im Braukessel zur Aromatisierung.
- Single-Hop IPA-Ansatz: Basis mit höherem Alkoholgehalt, Bitterung mit Apolon nach 60 Minuten, Whirlpool bei 80°C für 15–20 Minuten und kräftiges Kalthopfen mit Apolon.
- Gemischter IPA-Ansatz: Apolon für das Rückgrat plus Citra, Mosaik oder Amarillo für fruchtbetonte späte Ergänzungen.
Da Lupulinpulver nicht erhältlich ist, verwenden Sie Apolon-Pellets oder ganze Dolden. Bevorzugen Sie frische Ernten und erhöhen Sie die Hopfengaben beim späten Hopfengang und beim Kalthopfen älterer Hopfensorten, um den Ölverlust auszugleichen.
Planen Sie Ihre Einkäufe entsprechend den Braumengen. Die Erträge sind erfahrungsgemäß gering, was zu Engpässen führen kann. Lagern Sie Apolon gefroren in vakuumversiegelten Beuteln, um die Alpha-Säuren und Öle für das Heimbrauen zu erhalten.
- Messen Sie den Alpha-Wert Ihrer Hopfen bei Ankunft und berechnen Sie die IBUs neu.
- Nach 60 Minuten mit Apolon bitteren Sirup für einen stabilen Körper.
- Beim Whirlpool und beim Kalthopfen Apolon hinzufügen, um Zitrus- und Harzaromen hervorzuheben.
- Für eine stärkere tropische Note mit fruchtbetonten Sorten mischen.
Kleine Anpassungen bei Brauzeit und -menge ermöglichen die Feinabstimmung eines Apolon IPA-Rezepts. Man kann eine ausgeprägte Bitterkeit oder ein harziges Aroma anstreben. Dasselbe gilt für ein Apolon ESB-Rezept: Hier zielt man auf eine ausgewogene Malznote ab, ohne den Hopfencharakter zu überdecken.
Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen zu jedem Brauvorgang. Notieren Sie Alpha-Werte, Hopfengaben beim Kochen, Whirlpool-Temperaturen und Dauer des Kalthopfens. Diese Aufzeichnungen sind unschätzbar wertvoll, um ein Lieblingsrezept beim Brauen mit Apolon zu Hause nachzubrauen.
Anwendungsfälle im kommerziellen Bereich und Brauereibeispiele
Apolon ist bei Craft- und Regionalbrauereien sehr beliebt und bietet eine ausgewogene Mischung aus Bitterkeit und Zitrusaromen. Kleine und mittelständische Brauereien schätzen Apolon aufgrund seiner geringen Cohumulon-Bitterkeit. Diese Eigenschaft garantiert einen milden Geschmack, selbst nach längerer Lagerung im Tank.
Apolon wird häufig für IPAs, Extra Special Bitters und Starkbiere verwendet. Seine von Myrcen geprägten Aromen bringen Kiefern- und leichte Zitrusnoten hervor. Dadurch eignet er sich ideal für trocken gehopfte IPAs oder als Basishopfen für fruchtbetonte Sorten.
Spezialchargen und saisonale Editionen präsentieren häufig Apolon. Einige Craft-Brauer beziehen es von slowenischen Lieferanten für experimentelle Brauversuche. Diese Versuche liefern wertvolle Erkenntnisse für die Rezeptverfeinerung und die Skalierung der Produktion.
Große Brauereien stoßen bei der Einführung von Apolon auf betriebliche Hürden. Lieferengpässe aufgrund rückläufiger Anbauflächen schränken die Verfügbarkeit ein. Daher ist Apolon eher bei kleineren Brauereien als bei nationalen Marken verbreitet.
- Verwendung: Zuverlässige Bitterung mit harzigem Aroma für IPAs und starke Ales.
- Mischungsstrategie: Für mehr Komplexität in Bieren nach amerikanischer Art mit zitrusartigen Hopfensorten kombinieren.
- Beschaffung: Bezug von spezialisierten Hopfenhändlern; auf Frische achten (Erntejahr beachten).
In kommerziellen Bieren dient Apolon oft als unterstützende Zutat. Dadurch bleibt sein einzigartiger Charakter erhalten, während gleichzeitig das Gesamtaroma des Bieres verstärkt wird. Brauer können so komplexe Aromen kreieren, ohne das Malz zu überdecken.
Die handwerklich ausgerichteten Fallstudien von Apolon liefern wertvolle Erkenntnisse. Sie beschreiben detailliert bewährte Verfahren für Dosierung, Zeitpunkt und Kombinationen von Kalthopfen. Diese Erkenntnisse helfen Brauern, eine gleichbleibende Bitterkeit und einen angenehmen Abgang zu erzielen, selbst bei der Skalierung von Pilotchargen.
Hinweise zu Regulierung, Namensgebung und Markenrechten
Die Namensgeschichte von Apolon ist komplex und hatte Auswirkungen auf Brauereien und Lieferanten. Ursprünglich als Super Styrian bekannt, wurde es später als slowenischer Hybrid Apolon neu klassifiziert. Diese Änderung führte zu Verwirrung in älteren Forschungsarbeiten und Katalogen.
Beim Hopfenkauf ist es wichtig, Verwechslungen mit ähnlich klingenden Namen zu vermeiden. Apolon sollte nicht mit Apollo oder anderen Sorten verwechselt werden. Eine eindeutige Kennzeichnung ist unerlässlich, um Fehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass die richtigen Hopfensorten geliefert werden.
Die Verfügbarkeit von Apolon im Handel unterscheidet sich von der großer Marken. Anders als Apollo und einige US-Sorten ist für Apolon kein allgemein anerkanntes Lupulin- oder Kryoprodukt erhältlich. Daher erhalten Käufer üblicherweise herkömmliche Blatt-, Pellet- oder züchterspezifische Verarbeitungsformen.
Für viele Hopfensorten bestehen gesetzliche Schutzbestimmungen. In Europa, Nordamerika und anderen Regionen sind die Registrierung von Hopfensorten und die Sortenschutzrechte weit verbreitet. Lieferanten sollten Registrierungsnummern und Züchtungsnachweise für Apolon angeben, um die rechtmäßige Verwendung zu gewährleisten.
Import- und Exportprozesse erfordern eine sorgfältige Dokumentation. Pflanzengesundheitszeugnisse, Einfuhrgenehmigungen und die Angabe der Sortenbezeichnung sind für internationale Hopfenlieferungen notwendig. Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente vor grenzüberschreitenden Käufen vollständig und korrekt sind, um Verzögerungen beim Zoll zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Namensgeschichte, um ältere Verweise auf Super Styrian mit der aktuellen Apolon-Namensgebung in Einklang zu bringen.
- Prüfen Sie, ob es sich bei den Produkten nicht um falsch gekennzeichnete Varianten mit ähnlichem Klang wie Apollo handelt.
- Erkundigen Sie sich bei den Lieferanten nach der Registrierung von Hopfensorten und etwaigen geltenden Züchterrechten.
- Bei der Einfuhr von Hopfen in die Vereinigten Staaten müssen phytosanitäre Dokumente und Einfuhrdokumente angefordert werden.
Durch die Einhaltung dieser Richtlinien können Brauereien die Konformität und Transparenz bei der Hopfenbeschaffung sicherstellen. Dieser Ansatz gewährleistet bewährte Verfahren, ohne sich auf eine einzige markenrechtlich geschützte Lieferkette zu verlassen.

Abschluss
Diese Zusammenfassung beschreibt die Herkunft, die chemische Zusammensetzung und die Brauanwendungen von Apolon. Apolon wurde Anfang der 1970er Jahre in Slowenien von Dr. Tone Wagner entwickelt und ist ein vielseitiger Hopfen. Er weist einen Alpha-Säuregehalt von 10–12 %, einen niedrigen Co-Humulongehalt von ca. 2,25 % und einen Gesamtölgehalt von 1,3–1,6 ml/100 g auf, wobei Myrcen mit etwa 63 % dominiert. Diese Eigenschaften beeinflussen seine Verwendung beim Brauen maßgeblich.
Die praktischen Hinweise zum Brauen mit Apolon sind unkompliziert. Seine Bitterkeit ist konstant, und sein Aroma bleibt am besten erhalten, wenn es spät oder als Kalthopfung hinzugefügt wird. Da Apolon weder Lupulin noch kryogene Produkte enthält, sind sorgfältige Handhabung, Lagerung und Lieferantenprüfung erforderlich, um seine Potenz und sein Aroma zu bewahren.
Bei der Planung von IPAs, ESBs und Starkbieren ist der Apolon-Hopfenführer unverzichtbar. Er eignet sich perfekt für Biere, die eine harzige, zitrusartige Basis benötigen. Die Kombination mit fruchtbetonten Hopfensorten kann die Komplexität erhöhen. Prüfen Sie vor dem Kauf stets die Verfügbarkeit beim Lieferanten und die Lagergeschichte, da Frische und Knappheit die Eigenschaften von Apolon stärker beeinflussen als die anderer gängiger Hopfensorten.
Weitere Informationen
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, könnten Ihnen auch diese Vorschläge gefallen:
- Hopfen beim Bierbrauen: Brewer's Gold
- Hopfen beim Bierbrauen: Sovereign
- Hopfen beim Bierbrauen: Waimea
